
aus dem Magazin ‚INTERVENTIONEN. Künstlerische Interventionen als dekoloniale Strategie?' führt in die fortdauernden kolonialen Verflechtungen innerhalb des deutschsprachigen Kulturbetriebs ein und zeigt dabei mögliche Strategien und Projekte auf, die in diese kolonialen Strukturen intervenieren.
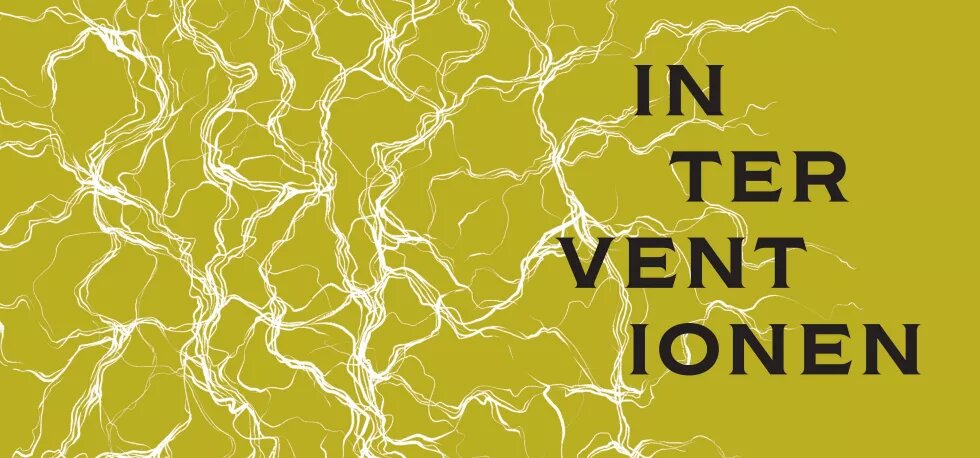
„Decolonial thinking is neither a discipline nor a method. It is a way of being, thinking, doing, and becoming in the world.“ (Walter Mignolo)
„Wenn es darum geht, die Gedanken zu dekolonisieren, müssen diese (…) beständig in Schwingung versetzt werden.“ (Maria do Mar Castro Varela)
Januar 2020, ein kleiner virtueller Streifzug durch die Programme deutscher (Kultur-) Institutionen: Im Thalia Theater in Hamburg wird eine postkoloniale Performance gezeigt. In Berlin findet gleichzeitig ein Seminar an der Universität der Künste über dekoloniale Kunstansätze statt. Und in einer kurzen Pressemitteilung des Humboldt Forums wird darüber informiert, dass sich die Eröffnung des Forums nun doch noch einige Monate verschieben wird. Der postkoloniale Diskurs scheint omnipräsent zu sein. Die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit und Gegenwart zeigt sich in Spielplänen, Programmen sowie Projekten und beschäftigt zurzeit zahlreiche Kulturschaffende. Auch eine kulturpolitischen Debatte setzt spätestens mit der Museumsdebatte 2018 ein, in der es unter anderem um den Umgang mit Restitutionsforderungen sowie Raubkunst geht, von vielen Seiten wird eine Dekolonisierung der Kunstinstitutionen und Künste gefordert. (1)
Julia Wissert, die erste Schwarze – und jüngste – Intendantin Deutschlands (Schauspielhaus Dortmund), beobachtet, dass der Hype um den deutschen Kolonialismus an den deutschsprachigen Bühnen nach dem Sommer der Migration 2015 eingesetzt hat (2). Sie kritisiert jedoch, dass dieser neuen postkolonialen deutschen Ästhetik nach wie vor noch eine weiße Perspektive als Ausgangspunkt zugrunde liegt und Inszenierungen für ein weißes Publikum imaginiert werden. Dies zeigt sich zum Beispiel im Fehlen von BIPoC-Perspektiven oder deren Fremdkontextualisierung auf Bühnen und macht die nach wie vor existierenden Leerstellen deutlich. Bis auf wenige Ausnahmen bestehen die künstlerischen Leitungsteams deutscher Staatstheater vor allem aus weißen Personen, vor allem Männern; ein ähnliches Muster lässt sich in der Besetzung der Ensembles erkennen.
Aber was hat das genau mit Postkolonialismus zu tun und was ist eigentlich mit dem Begriff gemeint? Kolonialismus ist doch längst vorbei, und Deutschland war im Vergleich zu anderen Imperialmächten nur für kurze Zeit Kolonialmacht – so wurde jedenfalls oft argumentiert, wenn über die Relevanz des Themas gesprochen wird. Wieso wird darüber diskutiert, wie eine Dekolonisierung möglich ist, wenn der Großteil der ehemals kolonisierten Staaten längst unabhängig ist?
Doch hinter diesen Begriffen stecken Strukturen, die bis heute wirkmächtig sind. Die Auswirkungen des Kolonialismus sind stark mit unseren gegenwärtigen Lebensrealitäten, den Denk- und Arbeitsweisen und Machtstrukturen verknüpft und finden sich auch in Kulturinstitutionen und künstlerischen Praktiken wieder. Diesen Verknüpfungen gehe ich genauer nach, um aufzuzeigen, dass eine Dekolonisierung der Künste in Deutschland dringend notwendig ist, um hegemoniale Strukturen aufzubrechen.
Dafür ist es zunächst zentral, die Konzepte und Ideen, welche hinter den Begriffen Postkolonialismus und Dekolonisierung stehen, genauer zu betrachten: Der Soziologe Stuart Hall verdeutlicht in seinem Aufsatz „Wann war der ‚Postkolonialismus‘?“(3), dass Postkolonialismus nicht als Epochenbegriff zu verstehen ist. Dies ist ein bedeutender Ausgangspunkt des Diskurses. Denn es handelt sich eben nicht um eine abgeschlossene Epoche, Kolonialismus in seinen vielfältigen Formen ist nicht vorbei. Zahlreiche Wissenschaftler*innen, allen voran Hall, kritisieren diese lineare Ausrichtung des Konzepts und seine damit einhergehende Periodisierung. Für Hall steht Postkolonialismus nicht nur nach dem Kolonialismus, sondern er geht über ihn hinaus. Das bedeutet, dass die Auswirkungen der Kolonisierung nicht mit der Unabhängigkeit der ehemals kolonisierten Staaten und Communitys beendet ist, im Gegenteil: Wir befinden uns noch immer inmitten des Prozesses der Dekolonisierung, das formale Ende der Kolonialreiche ist nicht gleichzusetzen mit dem Ende kolonialer Herrschaftsstrukturen. Reparationszahlungen – bis zum heutigen Tag noch nicht erstattet – sind nur ein erster Schritts, vielmehr muss an einer umfassenden Dekolonisierung angesetzt werden. Ein Bereich ist zum Beispiel die Dekolonisierung des Wissens: Was wird unter sogenannter Weltliteratur verstanden, oder aus welchen Inhalten besteht der Bildungskanon der Schulsysteme?
Ein zentraler Mechanismus kolonialer Strukturen ist die binäre Ausrichtung sowie Unterteilung in Kategorien wie kolonialisierend/kolonialisiert oder hier/dort und damals/heute, diese finden sich auch aktuell noch in Diskursen. Die Peripherie wird vom Zentrum an den Rand gedrängt, in Kulturinstitutionen gibt es weiterhin eine starke Tendenz zu einer hierarchischen Unterteilung in high culture/low culture. Der Historiker Achille Mbembe kritisiert diese Einteilung in Gegensätze, seiner Meinung nach verschleiert diese binäre Unterteilung vielmehr die postkolonialen Verbindungslinien und erschwert es, die postkoloniale Kontinuität in den Strukturen und Prozessen offenzulegen (4).
Für den Prozess der Dekolonisierung ist es somit zentral, sich von binären Kategorien zu lösen und die Gegenwart sowie die Vergangenheit als Verflechtung zu begreifen:
„Geschichte, so das postkoloniale Credo, verläuft dabei nicht linear, sondern mäandernd, vielschichtig und kontingent – ganz wie ein rhizomisches Netzwerk, das zahlreiche Verknüpfungen und Interdependenzen aufweist und dabei immer wieder neue und unerwartete Früchte hervortreibt.“ (5)
Die Ethnologin Katharina Schramm nutzt zur Beschreibung von Postkolonialismus den Begriff Rhizom (6) aus der Botanik. Sie sieht in postkolonialer Kritik die Möglichkeit zu einem historischen Perspektivwechsel, der diese fortdauernde Verwobenheit aufzeigt. Auch im Sinne von Shalini Randerias Konzept der ‚entangled histories‘ steht alles miteinander in Bezug, die Ethnologin zeichnet ein transnationales Geschichtsbild aus Abhängigkeiten, Interferenzen und Verflechtungen, das das Fortbestehen und Nachwirken der Effekte kolonialer Herrschaft deutlich macht. (7)
Von besonderer Bedeutung für die Konzepte des Postkolonialismus ist eine lateinamerikanische Forschungsgruppe, die sich mit Formen der Dekolonisierung eingehend beschäftigt. Der Ausgangspunkt ist hierbei eben jener Kontinent, der seit 500 Jahren verschiedene Formen von kolonialer Macht erlebt. Trotz der Unabhängigkeitsprozesse, die zahlreiche lateinamerikanische Länder seit dem 19. Jahrhundert durchleben, verändern sich die sozialen Zustände kaum. Die interdisziplinäre Forschungsgruppe Moderne-Kolonialität/Dekolonialität nimmt Aníbal Quijanos Konzept der Kolonialität (coloniality) (8) als Dreh- und Angelpunkt ihrer Forschungen. Kolonialität und Modernität sind hierbei unvermeidbar miteinander verknüpft. Das westliche Konzept von Moderne, das sich durch die Aufklärung etablierte, wurde nach Quijano sogar erst durch Kolonialismus, Versklavung und Ausbeutung hervorgebracht. Er unterteilt Kolonialität in coloniality of power, coloniality of knowledge und coloniality of nature: Sei es die Kontrolle über Wirtschafts- und Bildungssysteme, oder seien es die zahlreichen Landenteignungen und Ausbeutungen natürlicher sowie menschlicher Ressourcen – die Fäden der Kolonialität spinnen sich weltweit aus.
Um diese kolonialen Machtstrukturen zu dekonstruieren und zu verlernen, müssen die bestehenden hegemonialen Strukturen von Macht über Ökonomie, Politik, Körper und Wissensproduktion kritisch hinterfragt werden. Der Literaturwissenschaftler Walter Mignolo, der Teil dieser Forschungsgruppe ist, spricht vom Prozess des Entkoppelns, delinking, der in Gang gesetzt wird, um Kolonialität aufzubrechen (9).
Sowohl Halls Gedanken zum Postkolonialismus wie auch die lateinamerikanische Forschungsgruppe um Quijano und Mignolo legen den Fokus auf die Kontinuität kolonialer Machtverhältnisse. Sie zeigen dadurch, dass koloniale Verstrickungen und ungleiche Machtverteilung bis in die Gegenwart wirken. Diese Verstrickungen offenzulegen, ohne sie zu reproduzieren, ist eine der wesentlichen Herausforderungen von Dekolonisierungsprozessen.
Audre Lordes’ Grundsatz The Master’s tools will never dismantle the Master’s house (10) ist in diesem Prozess eine zentrale Devise. Lorde beschreibt mit ihrem Sinnbild sehr treffend die Krux, dass mit kolonialen Werkzeugen eine Dekolonisierung nicht möglich ist. Auch Mignolo betont, wie wichtig es ist, neue, eigene Denkinstrumente zu etablieren: „Thinking in/on our own terms is crucial for you cannot tear down the fiction with the same concepts with which the fiction was constructed.“(11)
Es zeigt sich also, dass Strategien zur Dekolonisierung notwendig sind und zahlreiche Wissenschaftler*innen sich damit auseinandersetzen, wie koloniale Kontinuitäten aufgebrochen werden können. Der virtuelle Streifzug durch die derzeitige Kulturlandschaft am Anfang des Textes macht deutlich, dass auch im Kulturbereich vielseitig darüber diskutiert und künstlerisch gearbeitet wird. Kulturinstitutionen, Künstler*innen und Kurator*innen suchen nach dekolonialen Strategien und künstlerischen Ansätzen. So lässt sich beobachten, dass in den letzten Jahren zahlreiche Strategien erprobt wurden, zum Beispiel Sharing-Konzepte und kollaborative Formen der Zusammenarbeit. Besonders in Kulturinstitutionen gab es einen rasanten Anstieg dieser „kollaborativen, dekolonialen Projekte“, die die bisherigen Hierarchien und die Deutungs- und Entscheidungshoheit weißer Entscheidungsträger*innen bei künstlerischen Projekten durchbrechen sollten. Meiner Meinung nach ist die Umsetzung dieser Konzepte jedoch in vielen Fällen fraglich, die Master’s tools werden weiterhin verwendet und so koloniale Muster reproduziert, die doch eigentlich vermieden werden wollen. Vielleicht werden Begriffe wie dekolonial und kollaborativ derzeit aber auch so inflationär von Institutionen verwendet, weil dadurch leichter Fördergelder zu akquirieren sind.
An vielen Museen folgte als Reaktion auf die Dekolonisierungsforderungen der „Ruf nach multiperspektivischen Ausstellungen“ (12) und eine Reflexion der überwiegend von weißen Künstler*innen und Kurator*innen durchgeführten Projekte. Für die Ethnologin Andrea Scholz bedeutet Dekolonisierung von Kulturinstitutionen vor allem eine selbstreflexive, kritische Beschäftigung mit der eigenen Arbeitsweise und Geschichte. Doch diese Selbstreflexion birgt die Problematik der Selbstreferentialität, da die weiße Perspektive im Fokus steht und als Ausgangspunkt gedacht wird; dadurch werden jahrhundertealte Strukturen erneut manifestiert.
Dies trifft auch im besonderen Maße auf (Museums-)Archive zu. Diese europäische Einrichtung sind zentrale Machtinstrumente der Geschichtsschreibung und spiegeln die – oft rassistische und menschenunwürdige – anthropologische Sammelpraxis der vergangenen Jahrhunderte wider. Es muss hinterfragt werden, welche Objekte und Materialien aufgrund welcher Entscheidungen ins Archiv gelangten, sowie was im Gegenzug alles nicht archiviert wurde, weil es als irrelevant erachtet wurde oder weil es sich einer Archivierung entzogen hat. Die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange beschäftigt sich damit, wie zukünftig mit bestehenden Archiven umgegangen werden kann: „Ein Archiv der Zukunft wäre in diesem Sinne eines, in das erst einmal überhaupt eingeschrieben wird, was nicht archiviert ist, von dem man aber gerne hätte, dass es archiviert wäre – sozusagen das Imaginäre als eine Vorübung für das reale Archiv –, und es wäre damit eine Verhandlungsebene, die die anderen Archive in eine Relation setzt.“(13)
Postkoloniale Machtverhältnisse in der Kunst- und Sammelpraxis werden also bereits hinterfragt, sowohl im Ausstellungskontext sowie in anderen Sparten und auf anderen Ebenen, zum Beispiel beim Personal und Publikum. Doch wie von Julia Wissert kritisiert, ist das aktuelle Aufgreifen der postkolonialen Debatte durch Kulturinstitutionen und Künstler*innen nicht gleichbedeutend mit einer automatischen Dekolonisierung: Wenngleich nach Natalie Bayer (u.a.) „(…) vielerorts von ‚postkolonialen‘ und ‚postmigrantischen’ Museumsansätzen gesprochen wird, geschieht dies oft bei gleichzeitiger Weiterführung erotisierender, hierarchisierender und gegenüberstellender Erzählmuster“ (14). BIPoC-Künstler*innen und deren Perspektiven werden zwar mit einbezogen in sogenannte postkoloniale Projekte, sie fungieren jedoch in vielen Fällen weiterhin als Objekte, anstatt als Subjekte der Wissensproduktion teilzuhaben und mitzugestalten.
Im Magazin liegt der Fokus deshalb auf künstlerischen Interventionen, da diese meiner Auffassung nach von Künstler*innen als dekoloniale Strategie genutzt werden, um die diese Erzählmuster zu durchbrechen und aufzuzeigen.
Für eine nachhaltige, ernsthaft betriebene Dekolonisierung der Kunst muss an den Basisfundamenten angesetzt werden: Begriffe, Ziele, Methoden und Strategien müssen kritisch hinterfragt werden, um hegemoniale Strukturen, Privilegien Einzelner und Ausschlüsse abzuschaffen. Sowohl Institutionen sowie weiße Künstler*innen und Kulturschaffende müssen ihre Produktionsweisen kritisch in den Blick nehmen. Denn nicht jedes Projekt, das als post- oder dekolonial bezeichnet wird, ist ohne Weiteres davor gefeit, hegemoniale Strukturen fortzuschreiben. Ungleichheiten bleiben bestehen und festigen sich; hierbei spielt auch die prekäre Finanzierung künstlerischer Projekte eine erhebliche Rolle. Hegemoniale Förderstrukturen ermöglichen kaum langfristige Kollaborationen und nachhaltige Zusammenarbeit sondern erhalten die Machtpositionen einiger weniger Institutionen und Personen aufrecht.
Als Reaktion darauf entstehen verstärkt kollaborative Kulturräume, die von BIPoC-Kulturschaffenden initiiert werden – Räume, in denen marginalisierte Perspektiven gehört werden und die nicht ausschließlich oder gar nicht für weiße Rezipient*innen konzipiert sind. Das Online- Magazin Contemporary And (C&), das zeitgenössische Kunstpraxis aus afrikanischer Perspektive und der Diaspora reflektiert und somit digitale Räume für multiperspektivische Stimmen schafft, ist hierfür ein Beispiel. SAVVY Contemporary (15) in Berlin, das sich als Raum für epistemologische Vielfalt bezeichnet sowie westliche Kunstpraxis kritisch hinterfragt und Konstrukte zerlegt und die M.Bassy in Hamburg als öffentlicher Salon für Begegnung mit zeitgenössischen afrikanischen und afrikanisch beeinflussten Künstler*innen und Kreativen sind weitere Exempel. Diese Projekte zeigen, dass bereits zahlreiche neue Strategien entwickelt werden, um dekoloniale Prozesse in künstlerischen Arbeitsweisen und Strukturen zu integrieren oder als Ausgangspunkt zu nehmen.
Gedanken werden in Schwingung versetzt, wie Maria do Mar Castro Varela so treffend schreibt (16). Es gibt bereits zahlreiche Projekte und Institutionen, die dabei sind, die Master’s tools zu zerlegen und durch neue Werkzeuge zu ersetzen– der Prozess läuft und ist noch lange nicht abgeschlossen.
Literatur
(1) Vgl. Förster, Larissa (2019): Der Umgang mit der Kolonialzeit: Provenienz und Rückgabe. In: Edenheiser, Iris/ Förster, Larissa (Hg.): Museumsethnologie. Eine Einführung: Theorien, Debatten, Praktiken. Berlin: Dietrich Reimer-Verlag. 78–103
(2) Vgl. Wissert, Julia (2018): Was würden wir atmen, wenn weiße Menschen nicht die Luft erfunden hätten? In: Liepsch, Elisa / Warner, Julian/ Pees, Matthias (Hg.): Allianzen. Kritische Praxis an weißen Institutionen. Bielefeld: Transcript Verlag. 244–260
(3) Vgl. Hall, Stuart (1997): Wann war „der Postkolonialismus“? Denken an der Grenze. In: Bronfen, Elisabeth/ Marius, Benjamin/ Steffen, Therese (Hg.): Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte. Tübingen: Stauffenburg-Verlag. 219–246
(5) Schramm, Katharina (2017): Einführung. In: Bauer, Susanne/ Heinemann, Torsten/ Lemke, Thomas (Hg.): Science and technology studies. Klassische Positionen und aktuelle Perspektiven. Berlin: Suhrkamp-Verlag. 471–494 (475)
(6) Das Konzept des Rhizoms wurde von Gilles Deleuze und Félix Guattari (3) eingeführt, die Metapher des Wurzelgeflechts dient dazu, vernetzte, heterogene Strukturen zu beschreiben, wie zum Beispiel das Aufkommen des World Wide Web in den 1990er Jahren. // The concept of the rhizome was introduced by Gilles Deleuze and Félix Guattari. The metaphor of the root network serves to describe networked, heterogeneous structures, such as the emergence of the World Wide Web the 1990s.
(Deleuze, Gilles/ Guattari, Félix (1977): Rhizom. Berlin: Merve-Verlag)
(7) Conrad, Sebastian/ Randeria, Shalini (2013): Einleitung: Geteilte Geschichten – Europa in einer postkolonialen Welt. In: Conrad, Sebastian/ Randeria, Shalini/ Römhild, Regina (Hg.): Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 32-70
(8) vgl. Quijano, Aníbal (2000): Coloniality of Power. Eurocentrism, and Latin America. In: Nepantla: Views from the South 1 (3), 533-580; sowie
vgl. Mignolo, Walter D. (2014): Further Thoughts on (De)Coloniality. In: Broeck, Sabine/ Junker, Carsten (Hg.): Postcoloniality, Decoloniality, Black Critique. Joints and Fissures.
Frankfurt/Main: Campus-Verlag. 21–52
(9) Diese Art des dekolonialen Denkens beschreibt die Autorin Gloria Anzaldúa als border thinking, also Denken an der Grenze. Border thinking als Zustand und Reaktion auf die Wissensproduktion der Moderne. // The author Gloria Anzaldúa describes this kind of decolonial thinking as border thinking. Border thinking as a state and reaction to the knowledge production of modernity.
(Vgl. Anzaldúa, Gloria (1999): Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco : Aunt Lute Books)
(10) Lorde, Audre (2018): The Master’s tools will never dismantle the Master’s house. London: Penguin Classics.
(11) Mignolo, Walter D. (2014): Further Thoughts on (De)Coloniality. In: Broeck, Sabine/ Junker, Carsten (Hg.): Postcoloniality, Decoloniality, Black Critique. Joints and Fissures.
Frankfurt/Main: Campus-Verlag. 21–52 (42)
(12) Scholz, Andrea (2019): Transkulturelle Zusammenarbeit in der Museumspraxis: Symbolpolitik oder epistemologische Pluralisierung? In: Edenheiser, Iris/ Förster, Larissa (Hg.): Museumsethnologie. Eine Einführung: Theorien, Debatten, Praktiken. Berlin: Dietrich Reimer-Verlag. 162–179 (165)
(13) Kuster, Brigitta/ Lange, Britta/ Löffler, Petra (2019): Archive der Zukunft? Ein Gespräch über Sammlungspraktiken, koloniale Archive und die Dekolonisierung des Wissens. In: Zeitschrift für Medienwissenschaft. Heft 20: Was uns angeht. Jg.11/1, 96–111 (106)
(14) Bayer, Natalie/ Kazeem-Kaminski, Belinda / Sternfeld, Nora (2017): Wo ist hier die Contact-Zone?! Eine Konversation. In: Bayer, Natalie/ Kazeem-Kaminski, Belinda / Sternfeld, Nora (Hg.): Kuratieren als antirassistische Praxis. Berlin/Boston: Walter de Gruyter-Verlag. 23–52 (23)
(15) Siehe URL: https://www.savvy-contemporary.com/de/ (10.07.2020)
Zur Arbeitsweise des SAVVY Contemporary: Ndikung, Bonaventure Soh Bejeng (2017): Perspectives from Berlin. Noa Ha and Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. URL: https://www.youtube.com/watch?v=VHJ6lDcQfVE (14.04.2020)
(16) Castro Varela, María do Mar (2007): Verlernen und Strategie des unsichtbaren Ausbesserns. Bildung und Postkoloniale Kritik. URL: http://www.igbildendekunst.at/de/bildpunkt/2007/widerstand-macht-wissen… (29.05.2020)

